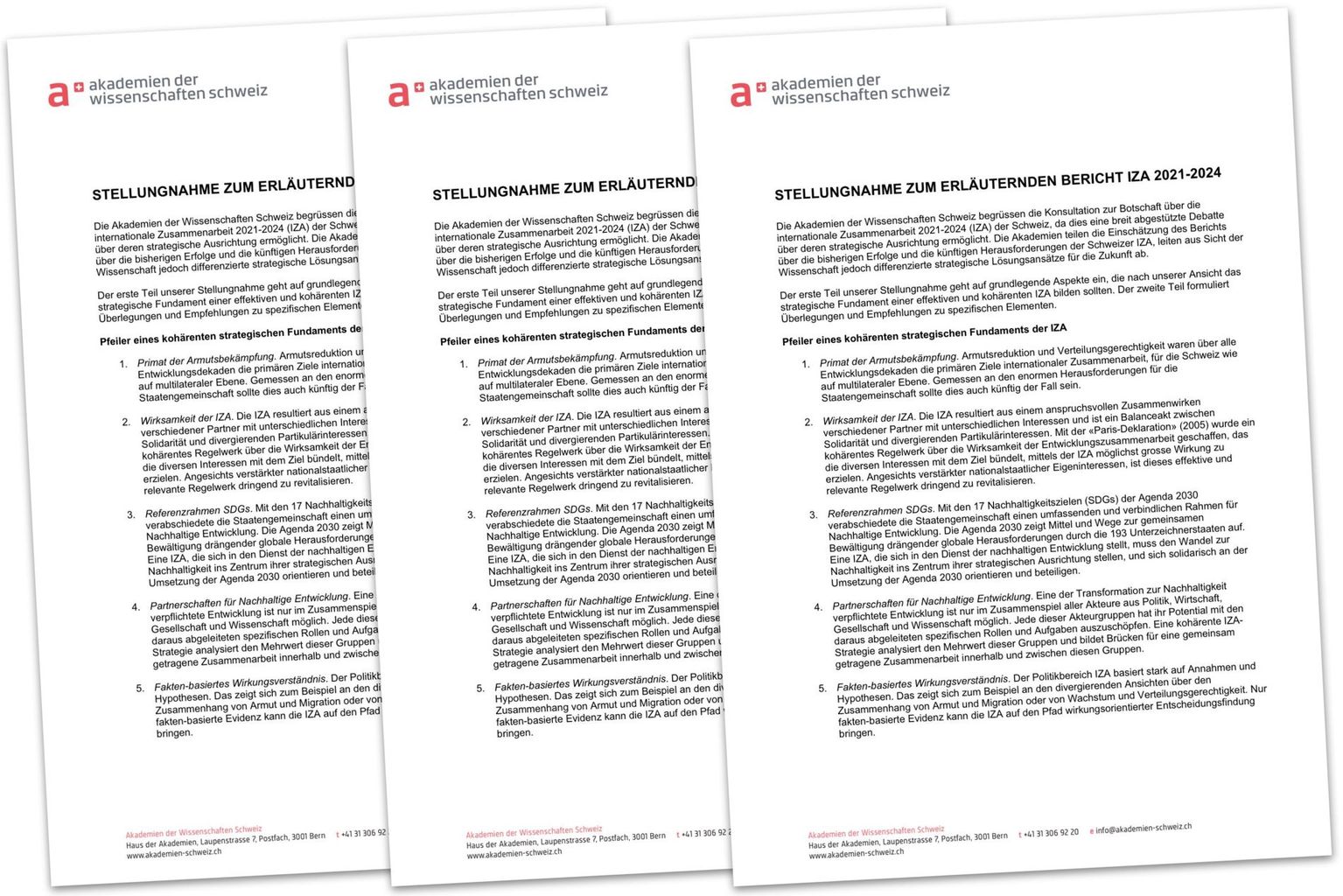Knowledge
ProClim is a scientific platform recognised across Switzerland that processes and compiles scientific fundamentals relating to climate change for the scientific community itself, the political milieu and society in general.
Reports, Factsheets and Publication Series
ProClim writes and publishes reports, fact sheets, publication series and position papers on the topics of climate, global change and energy.
File Climate
This file offers an overview of the state of knowledge in the fields of climate and global change. It is aimed at the scientific community, decision-makers, multipliers and the interested public.
Contact
SCNAT
Forum for Climate and Global Change (ProClim)
House of Academies
PO Box
3001 Bern
Switzerland
Current ProClim Publications

Checking in with … Regina Betz
At the beginning of July, the Energy Commission published a report on the future of nuclear energy in Switzerland. Co-author Regina Betz assesses the report from a climate science perspective.
Image: Die Volkswirtschaft
ProClim Flash 80: Eine Frage von Recht und Gerechtigkeit – die Rolle der Justiz im Klimawandel
Können Klimaklagen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit verbessern? Ist es zielführend, Klimaschutz als Menschenrecht einzuklagen, wie das die KlimaSeniorinnen getan haben? Sollte die Natur gar eigene Rechte haben? Wie stehen Menschen, die sich aktivistisch fürs Klima einsetzen, vor dem Gericht da? Und was, wenn Klimaschutzklagen als Form des Klimaaktivismus eingereicht werden? Schliesslich: Vor welche rechtlichen Herausforderungen stellt uns die «Klimamigration»? Die 80. Ausgabe widmet sich dem Thema «Eine Frage von Recht und Gerechtigkeit: Die Rolle der Justiz im Klimawandel». Der Flash gibt eine Übersicht über das komplexe Thema und beleuchtet verschiedene Aspekte aus wissenschaftlicher Perspektive.
Image: Miriam Künzli / GreenpeaceChecking in with… Géraldine Pflieger
Last November, the 29th United Nations Climate Change Conference (COP29) took place in Baku, Azerbaijan. Amongst the official Swiss delegation was Géraldine Pflieger, representing the scientific perspective. She is a is a professor of urban and environmental policy at the University of Geneva. After the conference, we were able to have a talk with Professor Pflieger and get a scientific evaluation of what was – or was not – decided at COP29.
Image: Andres Jordi, SCNAT
Register now for the 25th Swiss Global Change Day
Look beyond the horizon of climate and global change research and register now for the 25th Swiss Global Change Day on 9 April 2025. In addition to expert talks, we will provide you plenty of time to present your own research or organisation with a poster or at a stand and to network with colleagues. The most attractive and comprehensive posters submitted by students or postdocs will be honoured with a travel award of 1000 francs.